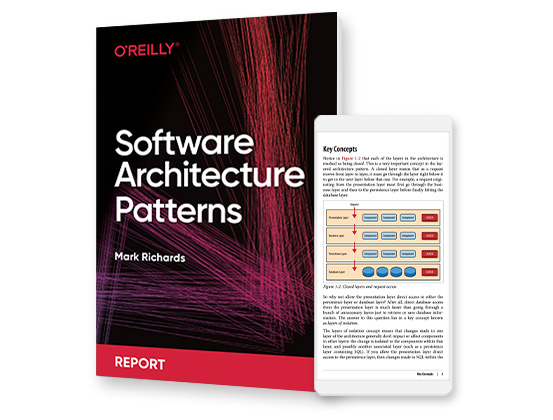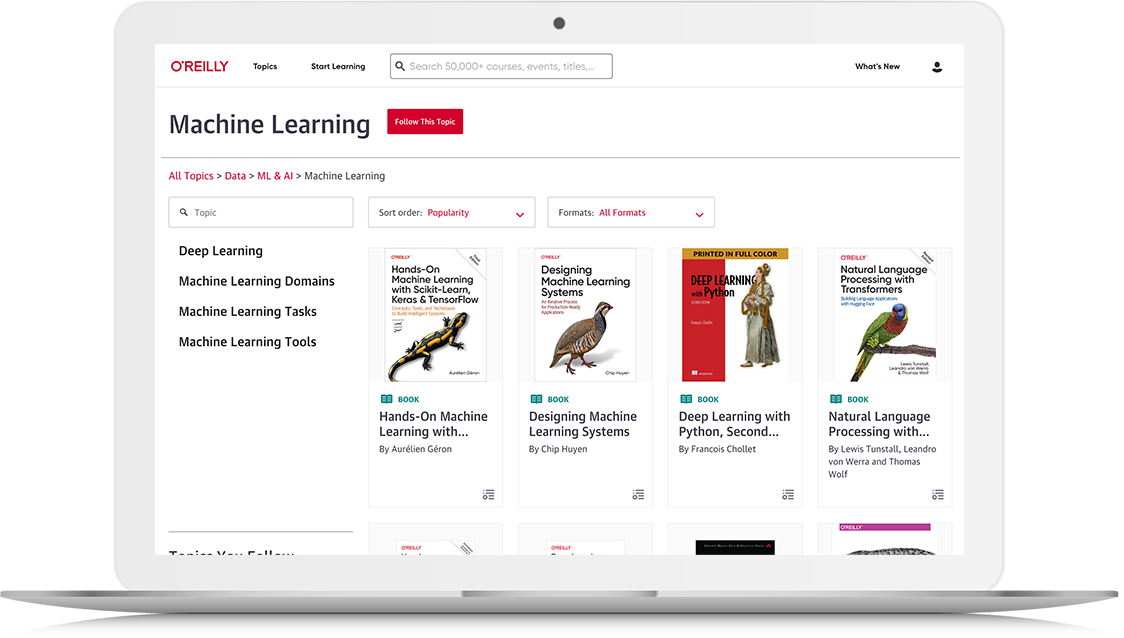Book description
Hohe Wettbewerbsintensität, Kostenbelastung und Preisdruck: Neben der Sicherstellung ökonomischer Vorteilhaftigkeit muss unternehmerisches Handeln zunehmend auch gesellschaftlich akzeptiert und ökologisch verträglich sein. Die Anforderungen an das betriebswirtschaftliche Instrumentarium wachsen entsprechend und somit auch die Ansprüche an ein unternehmerisches Reporting: Interne und externe Empfänger erwarten relevante, flexibel und zeitnah verfügbare Informationen.
Im vorliegenden Buch erfolgt neben der Darstellung zentraler Basis-Zusammenhänge eine gezielte Verknüpfung des Reportings mit einer transparenten Kennzahlenanalyse und einem entscheidungsorientierten Controlling. Wesentliche Einflussfaktoren (wie z. B. die Internet-Nutzung, vielfältige Visualisierungsformen, Verhaltensphänomene im Reporting) werden in ihren Auswirkungen eingebunden.
Eine konzeptionelle Weiterentwicklung des Profit Center-Ansatzes und seine Kombination mit der Nachhaltigkeits-Implementierung im Sinne der drei Dimensionen „Profit – People – Planet" zu Sustainability Balanced Scorecards zeigt das Eignungspotenzial eines ganzheitlichen, flexibel gestaltbaren Reportings als Management-Instrument.
Ein zahlengestütztes Fallstudien-Beispiel ermöglicht die gedankliche und zugleich rechnerisch-konkrete Reporting-Umsetzung mit mehr als 170 Fragen, die sich auf einen Zeitraum von fünf Perioden beziehen und sich an den spezifischen Interessenlagen interner und externer Adressaten (Stakeholder) orientieren.
Mit diesem gleichermaßen konzeptionell wie anwendungsnah ausgerichteten Reporting-Buch sind vor allem (potentielle) „Sender" wie auch „Empfänger" der unternehmerischen Berichterstattungspraxis angesprochen. Das Buch wendet sich daher ebenso an Dozenten als auch an Bachelor- und Master-Studierende der Wirtschaftswissenschaften in Präsenz- und Fernstudiengängen:
- Anschauliche Darstellung der betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge und innovativer Reporting-Formen
- Über 170 aussagefähige Profile zu ökonomischen, sozialen und ökologischen Kenngrößen
- Modular aufgebaute Fallstudie (also auch in kleineren Teilen einsetzbar) mit Lösungshinweisen zu allen der mehr als 170 Fragen
Table of contents
- Cover
- Title Page
- Impressum
- Vorwort
- Inhaltsverzeichnis
- Detaillierte Übersicht zu den Kenngrößen-Profilen
- Abbildungsverzeichnis
- 1 Einleitung
-
2 Ganzheitliches Reporting: Konzeptionelle Inhalte und Abgrenzungen
-
2.1 Betriebswirtschaftliche Basis-Zusammenhänge und ergänzende Sichtweisen im Reporting
- 2.1.1 Reporting als wesentlicher Bestandteil des Rechnungswesens und des Controllings
- 2.1.2 Einsatz von Kennzahlen als zentrale Reporting-Instrumente zur Führung von mehrstufig strukturierten Unternehmen
- 2.1.3 Konstitutive Merkmale kennzahlengestützter Reporting- und Analysesysteme
- 2.1.4 Erweiterung des Reporting-Grundmodells um die ORSI-Modellkomponente
- 2.1.5 Verhaltenspsychologische Phänomene in Reporting-Prozessen: Störungsursachen und mögliche Effekte von Heuristiken zu ihrer Bewältigung
- 2.1.6 Gestaltungsempfehlung einer Orientierung an anwendungsnahen Leitlinien: Grundsätze ordnungsmäßigen Reportings – GoR
-
2.2 Einflüsse von ausgewählten betriebswirtschaftlichen und IT-geprägten Entwicklungsrichtungen auf das Reporting
- 2.2.1 Shareholder- und Stakeholder-Konzeptionen
- 2.2.2 Corporate Social Responsibility- und Sustainability-Konzeptionen
- 2.2.3 Balanced Scorecard-Konzeptionen
- 2.2.4 Integrated Reporting-Konzeptionen
- 2.2.5 Business Intelligence-, Web Controlling- und Visual Business Analytics-Konzeptionen: Trendlinien der Datengewinnung, -übertragung und -aufbereitung
- 2.2.6 Referenzmodell „Corporate Sustainability Center Pyramid“ mit Gestaltungsempfehlungen: Ganzheitliches Reporting als Form eines Adaptable Corporate Reporting
-
2.1 Betriebswirtschaftliche Basis-Zusammenhänge und ergänzende Sichtweisen im Reporting
-
3 Fallstudie zu einem Stakeholder-orientierten Nachhaltigkeits-Reporting: Verknüpfung eines faktenfokussierten Berichtssystems des Fallstudien-Unternehmens mit einem umfassenden Fragenkatalog aus Stakeholder-Sicht
-
3.1 Zahlengestütztes Fallstudien-Unternehmen
- 3.1.1 Angaben aus dem finanzwirtschaftlichen Teil des Informationssystems
- 3.1.2 Angaben aus dem absatzwirtschaftlichen Teil des Informationssystems
- 3.1.3 Angaben aus dem produktionswirtschaftlichen Teil des Informationssystems
- 3.1.4 Angaben aus dem personalwirtschaftlichen Teil des Informationssystems
- 3.1.5 Angaben aus dem umweltwirtschaftlichen Teil des Informationssystems
- 3.1.6 Angaben aus dem sonstigen, allgemeinen Teil des Informationssystems
-
3.2 Typische Informationsinteressen (Fragen) aus der Sicht von internen Adressaten(-gruppen) in primären und sekundären Verantwortungsbereichen der unternehmerischen Wertschöpfungskette
- 3.2.1 Marketing/Verkauf/Kundenbeziehungs-Management
- 3.2.2 Güter-Produktion/Dienstleistungserstellung/ Komplexitätsmanagement
- 3.2.3 Beschaffung/Logistik/Supply Chain Management
- 3.2.4 Personal/Compliance/Innovations-Management
- 3.2.5 Rechnungswesen/Controlling/Finanzen
- 3.2.6 Weitere sekundäre Verantwortungsbereiche
-
3.3 Typische Informationsinteressen (Fragen) aus der Sicht von externen Adressaten(-gruppen) auf nationaler und internationaler Ebene
- 3.3.1 Eigen-/Fremdkapitalgeber – aktuelle und potentielle
- 3.3.2 Kunden/Lieferanten/Wettbewerber – aktuelle und potentielle
- 3.3.3 Arbeitnehmer/-vertretungen – aktuelle und potentielle
- 3.3.4 Fach-/Allgemein-Medien – aktuelle und potentielle
- 3.3.5 Öffentlichkeit/Staat/Non Governmental Organizations (NGOs) – aktuelle und potentielle
-
3.1 Zahlengestütztes Fallstudien-Unternehmen
- 4 Profile betriebswirtschaftlicher Kenngrößen – ausgerichtet am strukturellen Aufbau einer Sustainability Balanced Scorecard
-
5 Lösungshinweise zu den Fallstudien-Fragen
- 5.1 Allgemeine Erläuterungen
-
5.2 Interne Adressaten(-gruppen) in primären und sekundären Verantwortungsbereichen der unternehmerischen Wertschöpfungskette
- 5.2.1 Marketing/Verkauf/Kundenbeziehungs-Management
- 5.2.2 Güter-Produktion/Dienstleistungserstellung/ Komplexitätsmanagement
- 5.2.3 Beschaffung/Logistik/Supply Chain Management
- 5.2.4 Personal/Compliance/Innovations-Management
- 5.2.5 Rechnungswesen/Controlling/Finanzen
- 5.2.6 Weitere sekundäre Verantwortungsbereiche
-
5.3 Externe Adressaten(-gruppen) auf nationaler und internationaler Ebene
- 5.3.1 Eigen-/Fremdkapitalgeber – aktuelle und potentielle
- 5.3.2 Kunden/Lieferanten/Wettbewerber – aktuelle und potentielle
- 5.3.3 Arbeitnehmer/-vertretungen – aktuelle und potentielle
- 5.3.4 Fach-/Allgemein-Medien – aktuelle und potentielle
- 5.3.5 Öffentlichkeit/Staat/Non Governmental Organizations (NGOs) – aktuelle und potentielle
- 6 Zusammenfassung und Ausblick
- Literaturhinweise und Quellenverzeichnis
- Stichwortverzeichnis
- Fußnoten
Product information
- Title: Ganzheitliches Reporting als Management-Instrument
- Author(s):
- Release date: April 2016
- Publisher(s): De Gruyter Oldenbourg
- ISBN: 9783110436884
You might also like
book
IT-Servicekatalog
Ein IT-Servicekatalog beschreibt IT-Services, die ein Dienstleister seinen Servicenehmern anbietet, in einer einheitlichen Systematik. Er ist …
book
Das ultimative DAX-Handbuch
DAX (Data Analysis Expressions) ist die Formelsprache für Power Pivot, PowerBI und Microsoft Analysis Services, um …
book
IT-Governance
IT-Governance ist Teil der Corporate Governance und besteht aus Handlungsfeldern, Zielen und Zwecken sowie prozessorientierten, strukturellen, …
book
Datenbankentwicklung lernen mit SQL Server 2022, 3rd Edition
SQL Server 2022 und die kostenlose Version SQL Server 2022 Express sind ideal, um in die …